N. A. Otto |
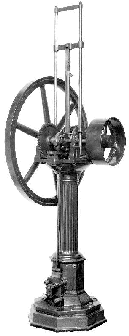 Bild 2: atmosphärische Gasmaschine um 1866/67 |
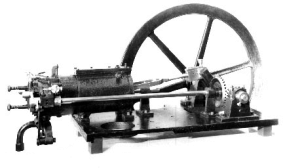 Bild 3: Versuchsmotor von 1876 |
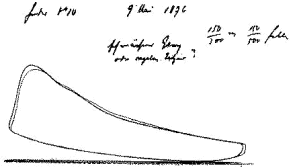 Bild 4: Arbeitsdiagramm vom 9. Mai 1876 |
Prinzipieller Aufbau eines Viertakt Ottomotors |
|
Aus der nebenstehenden Abbildung ist der prinzipielle Aufbau eines Viertakt-Ottomotors ersichtlich. Die hauptsächlichen Teile sind : Einlaßventil (EV) Auslaßventil (AV) Kolben (K) Verbrennungsraum (VR) Pleuelstange (P) Kurbelwelle (KW) Zündkerze (Z). |
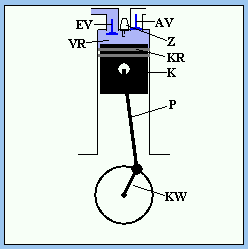 Bild 5: prinzipieller Aufbau |
Arbeitsweise - Einführung |
Ein Viertakt Ottomotor führt während seines Arbeitsspiels 4 Takte aus :
Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und Ausschieben.
Im ersten Takt (Ansaugen) ist das Einlaßventil geöffnet und der Kolben bewegt sich in Richtung Kurbelwelle. Durch den im Verbrennungsraum herrschenden Unterdruck wird ein Luft-Kraftstoffgemisch angesogen und füllt zum Ende des Taktes den Verbrennungsraum ganz aus. Das Enlaßventil schließt sich und der Kolben bewegt sich von der Kurbelwelle weg (Takt 2: Verdichten). Dabei wird das Luft-Kraftstoffgemisch stark verdichtet. Kurz vor Erreichen des oberen Totpunktes (OT) wird das Gemisch durch einen Funken an der Zündkerze gezündet (Zündzeitpunkt). Temperatur und Druck im Verbrennungraum steigen sprunghaft an. Durch den hohen Druck wird der Kolben wieder in Richtung Kurbelwelle gepreßt (Takt 3: Arbeiten). Am unteren Totpunkt (UT) öffnet das Auslaßventil und die Verbrennungsgase werden aus dem Verbrennungsraum ausgeschoben (Takt 4: Ausschieben). Insgesamt hat sich die Kurbelwelle nach den 4 Takten um 720° gedreht (2 vollständige Umdrehungen).
Arbeitsweise - Die Takte |
Die Menge aller möglichen Zustandspunkte einer Wärmekraftmaschine läßt sich in einem p-V-Zustandsdiagramm darstellen. Das entsprechende Diagramm für einen idealisierten Viertakt-Ottomotor ist in Bild 6 dargestellt.
|
Der einzelne Punkt im p-V-Zustandsdiagramm bezeichnet den aktuellen Zustand. Die Farbe des Verbrennungsraumes symbolisiert die dort herrschenden Temperatur (blau: kalt; rot: heiß). |
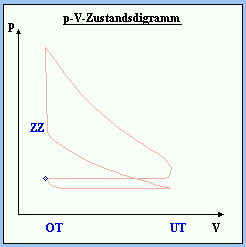 Bild 6: p-V-Zustandsdiagramm |
Der Kolben bewegt sich in Richtung Kurbelwelle. Das Einlaßventil ist geöffnet. Der Druck des im Zylinder befindlichen Restgases vermindert sich anfangs, da das Produlk aus p*V nahezu konstant ist. Das Luft-Kraftstoffgemisch wird durch den gebildeten Unterdruck angesaugt. |
Das Einlaßventil wird geschlossen und der Kolben bewegt sich in Richtung OT. Da sich dabei das Volumen vermindert, steigt der Druck des Gemisches an. Die zum Verdichten notwendige Arbeit erhöht die innere Energie des Gemisches - die Temperatur steigt. Da die Verdichtung sehr schnell erfolgt, wird nur ein geringer Teil der Wärme an die Umgebung abgegeben. |
Kurz vor Erreichen des oberen Totpunktes wird das Gemisch durch einen Funken an der Zündkerze gezündet (Zündzeitpunkt: ZZ). Das Gemisch verbrennt und setzt dabei Wärme frei. Diese Wärmemenge erhöht die innere Energie des Gemisches und damit die Temperatur. Die Temperatur steigt sprunghaft an. Da die Verbrennung in sehr kurzer Zeit erfolgt, verändert sich das Volumen dabei kaum (V=konstant). Für V=konst. gilt aber p1/p2 = T1/T2 - der Druck im Verbrennungsraum steigt sprunghaft an. Die auf den Kolben wirkende große Kraft (F= p * A) treibt den Kolben wieder in Richtung Kurbelwelle (Übergang zum 3.Takt). |
3. Takt: Arbeiten
Der Kolben bewegt sich bei geschlossenen Ventilen in Richtung Kurbelwelle. Das Volumen vergrößert sich und der Druck nimmt ab. Die sich ausdehnenden Gase verrichten eine Arbeit. Da keine neue Wärmemenge hinzukommt, vermindert sich die innere Energie und die Temperatur nimmt ab. |
Bei Erreichen des unteren Totpunktes (UT) öffnet das Auslaßventil. Der Kolben bewegt sich in Richtung oberer Totpunkt (OT). Durch das Öffnen des Auslaßventils sinkt der Druck auf einen Wert nahe dem äußeren Luftdruck.
|